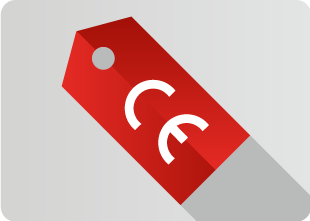
CE-Kennzeichnung – gesetzliche Pflicht, kein Prüfsiegel
Das CE-Zeichen ist kein Prüf- oder Qualitätssiegel, sondern ein Verwaltungszeichen. Es signalisiert, dass ein Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen aller zutreffenden europäischen Richtlinien erfüllt und somit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verkehrsfähig ist.
Die Verantwortung für die CE-Kennzeichnung liegt je nach Fall beim Hersteller, Importeur, einem EU-Bevollmächtigten oder einem Händler innerhalb der Lieferkette. Das Zeichen muss auf Produkten angebracht werden, für die eine harmonisierte europäische Produktsicherheitsvorgabe gilt.
Welche Richtlinie gilt für mein Produkt?
Derzeit gelten über 30 verschiedene CE-Richtlinien – jede mit spezifischen Anforderungen für unterschiedliche Produktgruppen. Ob ein Produkt überhaupt unter eine dieser Richtlinien fällt und welche davon anwendbar sind, ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar.
Entscheidend ist:
- Welche Richtlinien greifen?
- Reicht ein internes Konformitätsbewertungsverfahren aus?
- Muss benannte Stelle einbezogen werden (z. B. für Baumusterprüfungen oder Qualitätssicherung)?
Warum CE-Projekte komplex werden können
Für viele Produkte reicht eine eigenverantwortliche Konformitätserklärung aus – etwa durch die Anwendung harmonisierter Normen. Doch insbesondere bei Maschinen, Bauprodukten, Elektrogeräten oder Medizinprodukten kann die Bewertung komplex werden. Gründe sind unter anderem:
- Überschneidungen zwischen verschiedenen Richtlinien
- nationale Sonderbestimmungen
- sprachliche Anforderungen in der Nutzerinformation
- wechselnde technische Standards
In solchen Fällen ist Fachwissen allein nicht genug – hier braucht es technisches Verständnis, Dokumentationskompetenz und Projektsteuerung.
